Index
Regionenforschung

Die Regionenforschung am Institut umfasst in erster Linie die politikwissenschaftliche Nahostforschung (Naher Osten und Nordafrika) und Asienforschung (Ost- und Südostasien). Beide räumlichen Schwerpunkte sind verknüpft mit einem FAU-weiten Konsortium an islam-, nahost und asienbezogenen Fächern. Regionen begreifen wir als dynamische Gebilde, die weder homogen noch in sich geschlossen sind („Container“) – sie sind kontinuierlichen ökonomischen, politischen und kulturellen Einflüssen ausgesetzt, die durch intra- und interregionale Verflechtungen zwischen den Regionen deutlich werden. Konzeptionell und methodisch verortet sich die Erlanger Regionenforschung vor allem in der vergleichenden Politikwissenschaft mit Bezügen zur Internationalen Politik. Unsere intraregionalen, cross-regionalen und interregionalen Untersuchungen folgen einem kulturhermeneutischen Zugang und sind durch ausgeprägte Kontextsensibilität in der Berücksichtigung von Geschichte, Kultur und räumlichen Aspekten geprägt.
Laufende Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Heike Paul (Sprecherin, Co-PI), Prof. Dr. Thomas Demmelhuber (Co-PI), Dr. Katharina Gerund (Co-PI), Prof. Dr. Kay Kirchmann (Co-PI), Dr. Christian Krug (Co-PI), Prof. Dr. Marc Matten (Co-PI), Prof. Dr. Silke Steets (Co-PI)
Mitarbeiter: im Bereich der Politikwissenschaft: Antonia Thies, M.A., Andrea Klinger, M.A.
Laufzeit: 2022-2028
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Webseite: DFG-Graduiertenkolleg ‚Das Sentimentale in Kultur, Literatur und Politik
Projektbeschreibung: Das Graduiertenkolleg untersucht Formen und Funktionen des Sentimentalen in synchroner und diachroner Perspektive. Wir verstehen Sentimentalität als einen kommunikativen und relationalen Code, der auf emotionales Wissen zurückgreifen und Empathie aktivieren kann. Dieser Code kann in verschiedenen Bereichen beobachtet und untersucht werden, zum Beispiel aus der Perspektive der Politikwissenschaft, inwieweit politische Eliten auf Repertoires der Vergangenheit zurückgreifen, um Narrative einer kollektiven Wir-Identität zu generieren. Aus einer vergleichenden und interdisziplinären Perspektive konzentriert sich das Graduiertenkolleg sowohl auf kulturspezifische als auch auf inter- und transkulturelle Aneignungsprozesse dieses Codes in nationalen und transnationalen Kontexten.
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Katrin Kinzelbach
Projektmitarbeiterin: Dr. Alexandra Kaiser
Laufzeit: 1. Juli 2021 – 31. Dezember 2023
Förderung: BMBF
Projektbeschreibung:
Das Projektteam analysiert den rechtlichen Rahmen und die institutionelle Ausgestaltung sowie die Rechtswirklichkeit und die Praxis des Rechts auf Wissenschaftsfreiheit in der Volksrepublik China. Eine systematische, rechtliche und sozialwissenschaftliche Aufarbeitung der Wissenschaftsfreiheit in der Ära Xi Jinping ist von größter Bedeutung für den Versuch, die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen des chinesischen Forschungs- und Innovationssystems besser zu verstehen. Eine in den Vereinten Nationen verhandelte Definition von Wissenschaftsfreiheit wird als Maßstab übernommen. Neben der Analyse des geltenden Rechts, politischer Richtlinien sowie Universitätssatzungen in chinesischer Sprache werden wir ausgewählte Institutionen näher untersuchen, Interviews und eine Umfrage durchführen. Im Verbund mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) werden wir einen bibliometrischen Ansatz pilotieren, um die Freiheit des akademischen Austauschs nach Disziplinen disaggregiert zu messen. Ziel ist der wohlinformierte Ausbau der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China bei selbstbewusster Wahrung der Normen und Voraussetzungen, die in Deutschland und Europa als Fundament für Forschung und Innovation gelten.
Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Demmelhuber (Sprecher und PI), Dr. Julia Gurol (Co-PI, Freiburg), Dr. Tobias Zumbrägel (Co-PI, Heidelberg)
Laufzeit: 2021 – 2023
Förderung: Volkswagen Stiftung
Projektbeschreibung:
Im Rahmen der Ausschreibung „Corona Crisis and Beyond – Perspectives for Science, Scholarship and Society“ geht das Projekt „Global autocratic collaboration in times of COVID19: Game changer or business as usual in Sino-Gulf Relations?“ von der Prämisse aus, dass COVID19 als Booster für globale Autokratisierungsprozesse wirkt, in denen sich autokratische Akteure als effektivere Vorbilder im Kampf gegen die Pandemie präsentieren. Dies ist insbesondere in den chinesisch-golfarabische Beziehungen zu beobachten. Am Beispiel von Tracing-Apps und Überwachungstechnologien untersuchen wir die transregionalen Korridore des Austauschs zwischen China und den arabischen Golfstaaten, um zu zeigen, wie chinesische Narrative eines effektiveren Regierungsmodells diffundieren und perzipiert werden.
Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Demmelhuber (Co-PI), Prof. Dr. Roland Sturm (Co-PI)
Mitarbeiter: Miriam Bohn, M.A., Erik Vollmann, M.A.
Laufzeit: 2018-2022
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Projektbeschreibung:
Seit Anfang der 1990er Jahre sind in der arabischen Welt zahlreiche Dezentralisierungsstrategien zu beobachten, die nach den arabischen Aufständen im Jahr 2011 einen zusätzlichen Schub erhielten. Westliche Geber und Akteure der arabischen Zivilgesellschaft erwarteten eine stärkere Beteiligung und mehr Autonomie auf regionaler und lokaler Ebene. Doch die Ergebnisse der Reformen sind sehr unterschiedlich. Wir haben einen neuen konzeptionellen Ansatz für die Analyse von Dezentralisierungsprozessen in der arabischen Welt entwickelt. Wir gehen davon aus, dass die Dezentralisierung von informellen neopatrimonialen Elitenetzwerken auf nationaler, regionaler und lokaler Regierungsebene gesteuert, inspiriert und genutzt wird. Über den Indikator Fiskalpolitik lässt sich die Kluft zwischen den normativen Ansprüchen, die mit der formalen Dezentralisierung verbunden sind, und der viel komplexeren Realität von Dezentralisierung untersuchen.
Projektleitung: Prof. Dr. Thomas Demmelhuber (Co-PI), Prof. Dr. Marianne Kneuer (Co-PI, Hildesheim)
Mitarbeiter: Teilprojekt an der FAU: Dr. Tobias Zumbrägel
Laufzeit: 2015 – 2018
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Projektbeschreibung:
Die Widerstandsfähigkeit autokratischer Regime in verschiedenen Weltregionen und das Phänomen der Autokratisierung haben die Forschung zur internationalen Dimension des Autoritarismus verstärkt. Wir haben das Konzept des autoritären Gravitationszentrums entwickelt, um die Clusterbildung von Autokratien in regionalen Kontexten zu erklären und zu zeigen wie Autokratien andere „like-minded regimes“ unterstützen und ebenso zu Nachahmungseffekten (Diffusion) verleiten.
Projektleitung:
Mitarbeiter:
Laufzeit:
Förderung:
Webseite:
Projektbeschreibung:
Personen
Internationale Beziehungen und Politische Ökonomie

Der Arbeitsbereich Internationale Beziehungen und Politische Ökonomie forscht zu globalen Ordnungsfragen und den breiten Feldern der Außen(wirtschafts-) und Sicherheitspolitik. Die zentralen Forschungsschwerpunkte bilden dabei die transatlantischen Beziehungen sowie die deutsche, europäische und amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik unter besonderer Berücksichtigung der Geoökonomie und globaler Machtverschiebungen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Forschung zu westlichen Statebuilding– und Stabilisierungsinterventionen in (Post-)Konfliktgesellschaften sowie der Einfluss von nicht-staatlichen Gewaltakteuren auf Staatsbildungsprozesse. Hierbei liegt ein besonderer Fokus auf der politischen Ökonomie und Organisationstruktur von Rebellengruppen und dem langfristigen Einfluss von Bürgerkriegen auf Post-Konflikt-Staatlichkeit in Sub-Sahara Afrika.
Laufende Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Stefan Fröhlich & Prof. Dr. Ulrich Schlie
Laufzeit: 2023 – 2024
Projektbeschreibung:
Der Essay analysiert, weshalb es in den letzten Jahren immer wieder zu gravierenden außen- und sicherheitspolitischen Fehleinschätzungen, wie zum Beispiel den Illusionen der deutschen Energie- und Russlandpolitik, gekommen ist. Er wirbt zudem für eine Neubewertung des Ökonomischen als Teil der Außenpolitik, um nicht – beispielsweise beim Umgang mit China – auf einem anderen Feld erneut folgenreiche Fehlentscheidungen zu vollziehen. Stefan Fröhlich und Ulrich Schlie plädieren für einen grundlegenden strategischen Neuanfang. Sie skizzieren, wie deutsche Sicherheitspolitik künftig aufgestellt sein sollte, um den geoökonomischen und geopolitischen Erfordernissen einer veränderten Weltlage Rechnung zu tragen, in der die amerikanische Macht schwindet und autoritäre Mächte aufsteigen.
Projektleitung: Prof. Dr. Stefan Fröhlich
Laufzeit: 2023-24
Projektbeschreibung:
Der derzeitige globale geopolitische Machtkampf um Einflusszonen wird durch eine weitere Entwicklung verstärkt, die für Europa mittel- und langfristig mindestens ebenso entscheidend sein wird, die Frage nach seiner Verteidigungsfähigkeit: die wachsende Bedeutung der Geoökonomie. Weltweit greifen Regierungen auf wirtschaftliche Mittel zur Erreichung von außenpolitischen und ökonomischen Zielen, aber auch zur Erschließung von Einflusssphären zurück. Sie verstärken damit den Trend zu Nationalismen, Abschottung und Konfliktbereitschaft (Brexit, Trump, Chinas zunehmend aggressivere Haltung, Russland, Populismus in Europa wie USA). Zu den Instrumenten zählen dabei gezielte Sanktionen in den Bereichen Finanzen, Reisen, militärische Unterstützung und Handel, Exportbeschränkungen, aber auch die strategische Beschränkung oder Öffnung des Zugangs zu Anleihen, Finanztransaktionen oder Wirtschaftshilfe. In allen Fällen handelt es sich um protektionistische Maßnahmen, die den internationalen Austausch von Gütern, Kapital, Menschen oder Technologie behindern. Das Projekt fragt nach den adäquaten Antworten Europas und Deutschlands auf die geoökonomischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Projektleitung: Dr. Johannes Jüde
Laufzeit: 2022 – 2023
Förderung: Emerging Talent Initiative (ETI), Friedrich-Alexander-Universität: 7.777 €
Webseite: Emerging Talent Initiative (ETI)
Projektbeschreibung:
Das im Rahmen der ETI-Förderung entwickelte Forschungsprojekt zielt darauf ab, die Auswirkungen von nichtstaatlichen bewaffneten Bewegungen auf den Aufbau und den Zerfall von Staaten zu untersuchen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Regionen Sahel und Horn von Afrika liegt. Das Projekt wird die langfristigen Auswirkungen von Bürgerkriegen auf den Staatsaufbau und die Rolle externer Interventionen bei diesem Phänomen untersuchen. Durch einen multidisziplinären Ansatz, der auf Staatsbildungstheorien, Friedens- und Konfliktforschung und regionaler Expertise basiert, soll das Projekt neue Erkenntnisse über die komplexen Dynamiken des Staatsaufbaus und -zerfalls im Kontext bewaffneter Konflikte liefern. Die Ergebnisse dieser Forschung haben wichtige Auswirkungen auf Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Praktiker, die an Konfliktlösung und Staatsaufbauinitiativen in der Region arbeiten.
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Projektleitung:Prof. Dr. Stefan Fröhlich
Laufzeit: 2016 – 2017
Förderung: Transatlantic Academy, 50.000 $
Webseite: „Suspicious Minds – Report (PDF)
Die Stipendiaten der Transatlantic Academy kamen im September 2016 zusammen und waren bis Mai 2017 an der Akademie in Washington, DC, zu Gast. Sie nahmen an einer Reihe von Workshops und einer gemeinsamen Studienreise nach Europa teil und hielten wöchentliche Treffen ab, um sowohl ihre individuellen wissenschaftlichen Arbeiten als auch die abschließende gemeinsame Studie zu erarbeiten, die einige politische Ideen für die neue US-Regierung und die deutsche Regierung enthält.
Personen
Vergleichende Politikwissenschaft

Die Forschung in der Vergleichenden Politikwissenschaft am Institut umfasst ein breites Themenspektrum und deckt alle Ebenen des Regierens und eine große geographische Varianz ab. Zu den Themenschwerpunkten gehören neben den klassischen Feldern des Vergleichs wie Wahlen und Parteien im internationalen Vergleich politikfeldspezifische Schwerpunkte beispielsweise in der Umwelt-, Infrastruktur- oder Migrationspolitik. Darüber hinaus werden Prozesse der Demokratisierung und Autokratisierung oder politökonomische Veränderungsprozesse untersucht. Ein Alleinstellungsmerkmal des Instituts in Erlangen ist die breit gefächerte regionale Expertise, die sich über Deutschland und die Europäische Union hinaus auf Afrika (insbesondere die Region Sub-Sahara Afrika sowie Südafrika), China, Ost- und Südostasien, sowie auf den Nahen Osten und Nordafrika erstreckt.
Laufende Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Katrin Kinzelbach; Prof. Dr. Staffan I. Lindberg (V-Dem Institute, University of Gothenburg)
Mitarbeiter: Dr. Lars Pelke
Laufzeit: 01.09.2021 – 31. August 2026
Förderung: Volkswagen Stiftung
Webseite: https://www.academic-freedom-index.org
Projektbeschreibung:
Der UN-Sozialpakt verpflichtet 171 Unterzeichnerstaaten die Freiheit der Forschung zu achten. Der Academic Freedom Index untersucht, ob diese rechtliche Verpflichtung de facto eingehalten wird. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Politische Wissenschaft an der FAU Erlangen-Nürnberg und dem V-Dem Institut an der Universität Göteborg durchgeführt. Mit einer auf Experteneinschätzungen beruhenden und methodisch anspruchsvollen Erhebung, die auf probabalistischer Testtheorie basiert, werden umfassende Daten zur Realisierung von Wissenschaftsfreiheit open access zur Verfügung gestellt. Die Daten eröffnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Forschung aber auch in Wissenschaftsförderung, -management und –politik. Die Förderung ermöglicht auch zwei Postdoc-Projekte an der FAU, die sich den Ursachen und Folgen von Einschränkungen (respektive Verbesserungen) der Wissenschaftsfreiheit widmen.
Projektleitung: Prof. Dr. Sandra Eckert, Prof. Dr. Constantin Wurthmann, Dr. Simon Primus
Laufzeit: Mai 2024 – Mai 2025
Förderung: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e. V./ Luise Prell Stiftung/ International Association for the Study of German Politics
Projektbeschreibung:
Im Rahmen des Projektes EUROPOLVER hat der Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaften zwei Vorwahlbefragungen vor den Europawahlen 2024 in Deutschland und Österreich durchgeführt. Diese werden nun einerseits für Analysen genutzt, die Rückschlüsse auf die politische Kultur und Zufriedenheit mit der Demokratie in beiden Ländern zulassen. Andererseits soll untersucht werden, wie Vertrauen in politische Institutionen die Wahlentscheidung prägt. Ein Fokus soll dabei auf der Betrachtung der Wahlentscheidungsmotivationen liegen und wie diese den politischen Wettbewerb über die Europawahl hinaus verändern könnten.
Projektleitung:
Mitarbeiter:
Laufzeit:
Förderung: Volkswagen Stiftung
Webseite:
Projektbeschreibung:
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Sandra Eckert (FAU), Dr. Orr Karassin (Open University Israel), Prof. Yves Steinebach (LMU München)
Mitarbeiterin (FAU): Eklavya Vasudev
Laufzeit: 1. Januar 2022-31.12.2022
Förderung: Deutsch-Israelische Stiftung für Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung (GIF)
Projektbeschreibung:
Das deutsch-israelische Projekt „Regulating the Circular Economy and Plastics in the OECD World“ (kurz: RegCirc) untersucht erstmalig gesetzgeberische und freiwillige Maßnahmen, die in 12 OECD Staaten und von der Europäischen Union im Zeitraum 2001 bis 2021 zur Realisierung der Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe ergriffen wurden, und leistet hierdurch einen wichtigen Beitrag zur Forschung. Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme erforscht das Team die Bedingungen und Motive, die zu diesen Maßnahmen geführt haben, aber auch deren Wirkungsweise.
Personen
Politische Theorie und Ideengeschichte

In diesem Forschungsfeld steht die Moderne Politische Theorie und Ideengeschichte vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart im Vordergrund – und zwar in erster Linie in vergleichend-systematisierenden, begriffsgeschichtlichen und diskursanalytischen Vorhaben. Vier übergreifende Schwerpunkte verbinden die Projekte der beteiligten Forscher*innen:
- Internationales und globales politisches Denken (Fragen internationaler politischer Ordnung, von Föderalismus bis Imperialismus)
- Semantiken des Politischen und ihre Aushandlung und Vermittlung in politischen Bildern und Metaphern (politische Ikonologie und Metaphorologie).
- Konservatives, autoritäres und anti-demokratisches politisches Denken
- Regionalfokus auf englisch- und russischsprachige Debatten
Laufende Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Eva Marlene Hausteiner
Laufzeit: 2022-2024
Förderung: Volkswagen-Stiftung, Programmlinie „Originalitätsverdacht“
Projektbeschreibung:
Ist es planbar und wünschenswert, dass Ordnungen enden, und wer entscheidet dies? Unter welchen Bedingungen und mit welchen Begründungen entwickeln sich absichtlich endliche politische Systeme und worin besteht die Logik politischer Befristung? An der Schnittstelle zwischen politischer Ideengeschichte und systematischer politischer Theorie erforscht das Projekt Phänomene der Befristung und ihre theoretische Begründungen erforschen.
Projektleitung: Prof. Dr. Eva Marlene Hausteiner
Mitarbeiterin: Marina Solntseva
Laufzeit: 2023-2027
Förderung: DFG im Rahmen der Forschungsgruppe „Aitiologien“
Projektbeschreibung:
„Das politiktheoretische Forschungsprojekt untersucht die temporal-begründenden, also aitiologischen Erzählmuster der ideologischen Strömung des russischen Neo-Eurasianismus. Untersucht werden soll die erzählend-erklärende Behauptung einer im Mittelalter entstandenen und seitdem prägenden Auseinandersetzung zwischen Eurasien und dem Westen – ausgehend von der These, dass der Neo-Eurasianismus nicht allein als geopolitische Bewegung, sondern als aitiologische Konfliktnarrativierung verstanden werden muss. Im Projektfokus stehen dabei einerseits die narrativ-aitiologischen Mittel der Plausibilisierung dieses Konfliktes (inklusive ikonographischer Strategien und ideengeschichtlicher Traditionserzählungen), andererseits dessen Rolle in der Begründung einer aggressiven imperialen Programmatik.“
Projektbeschreibung:
Das Promotionsvorhaben von Laila Riedmiller untersucht vermittels einer ideengeschichtlichen Spurensuche temporale Strategien der „Neuen Rechten“, insbesondere deren Bezug auf die heterogene Denkströmung des Akzelerationismus. In vergleichender Perspektive wird dabei auch nach der möglichen Unterscheidbarkeit von linkem und rechtem Akzelerationismus gefragt.
Personen
Menschenrechte und Menschenrechtspolitik
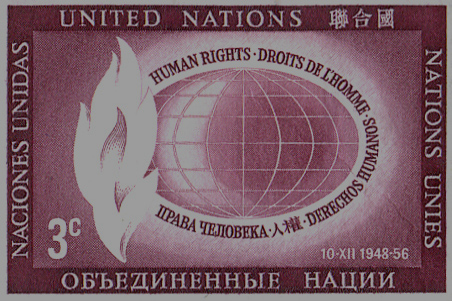
Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftspolitischer und internationaler Entwicklungen beschäftigt sich die Menschenrechtsforschung am Institut zum einen mit normativ-theoretischen Grundfragen der Begründung, Auslegung und anhaltenden Bedeutung von Menschenrechten; zum anderen werden empirisch die Menschenrechtslage und die Menschenrechtspolitik auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene untersucht. Dabei wird das gesamte Spektrum der Menschenrechte in den Blick genommen. Besondere Schwerpunkte unserer Arbeit liegen auf der Religionsfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit sowie den politischen und den sozialen Menschenrechten. Die Forschung ist eingebettet in einen interdisziplinären Menschenrechtschwerpunkt an der FAU, der im Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg (CHREN) fakultätsübergreifend koordiniert wird.
Laufende Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Katrin Kinzelbach; Prof. Dr. Georg Glasze und Prof. Dr. Blake Walker
Projektmitarbeiterinnen: Zuzana Jurasova
Laufzeit: September 2024 – April 2025
Förderung: ZEIT-Stiftung
Projektbeschreibung:
Im Rahmen einer Forschungswerkstatt arbeiten Studierende an der FAU Erlangen-Nürnberg im Wintersemester 2024/2025 mit dem Scholars-at-Risk-Netzwerk (SAR) zusammen. SAR ist ein an der New York University gegründetes, international tätiges Netzwerk, das sich für den Schutz von verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einsetzt. Die Teilnehmenden dieser Forschungswerkstatt befassen sich mit der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen im Hochschulsektor, recherchieren Einzelfälle und verfassen Länderberichte, die in Zusammenarbeit mit SAR beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingereicht werden.
Projektleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt
Zeitraum: 2020 – heute
Projektbeschreibung:
Gemäß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 bilden die Menschenrechte „die Grundlage …. des Friedens in der Welt“. Angesichts der fundamentalen Krise des regelbasierten Multilateralismus unternimmt Heiner Bielefeldt den Versuch, das friedensstiftende Potenzial der Menschenrechte genauer zu bestimmen, die Optionen unterschiedliche Akteur*innen in Beziehung zueinander zu stellen und damit zugleich realistische Hoffnungsperspektiven zu eröffnen. Die derzeit in Arbeit befindliche Monographie zu diesem Thema soll 2024 erscheinen.
Projektleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt
Zeitraum: 2009 – heute
Projektbeschreibung:
Die Religionsfreiheit ist ein politisch stark umkämpftes Menschenrecht. Zum einen wird sie in der Praxis vielerorts missachtet. Das Spektrum der Verletzungen reicht von strukturellen Diskriminierungen über die gezielte Indoktrination von Schulkindern bis zu KZ-ähnlichen Massen-Internierungen und genozidaler Gewalt. Zum anderen ist die Religionsfreiheit massiven Versuchen der Umdeutung ausgesetzt, die teils darauf abzielen, sie ins Antiliberale zu verbiegen. Deshalb erweisen sich Klarstellungen ihres normativen Gehalts und ihres Verhältnisses zu anderen Menschenrechten – etwa im Gender-Bereich – immer wieder als unumgänglich. Heiner Bielefeldt hat sich in vielfältigen Funktionen für die Religionsfreiheit engagiert. Zwischen 2010 und 2016 fungierte er als UN-Sonderberichterstatter für dieses Menschenrecht. Die im Rahmen dieser Tätigkeit verfassten thematischen und länderspezifischen Berichte liegen in allen sechs offizielle UN-Sprachen vor. Zu Bielefeldts einschlägigen Publikationen zählt ein bei Oxford University Press zusammen mit Nazila Ghanea (der aktuellen UN-Sonderberichterstatterin für Religionsfreiheit) und ein mit Michael Wiener verfasster ausführlicher Kommentar („Freedom of Religion or Belief: An International Law Commentary“, 2016), dessen erweiterte zweite Auflage derzeit vorbereitet wird. Sein zusammen mit Michael Wiener veröffentlichter Band „Religious Freedom Under Scrutiny“ (Pennsylvania 2020) liegt auch in deutscher und in indonesischer Sprache vor.
Projektleitung: Prof. Dr. Katrin Kinzelbach; Prof. Dr. Staffan I. Lindberg (V-Dem Institute, University of Gothenburg)
Mitarbeiter: Dr. Lars Pelke und Dr. Angelo Panaro
Laufzeit: 01.09.2021 – 31. August 2026
Förderung: Volkswagen Stiftung
Webseite: https://www.academic-freedom-index.org
Projektbeschreibung:
Der UN-Sozialpakt verpflichtet 171 Unterzeichnerstaaten die Freiheit der Forschung zu achten. Der Academic Freedom Index untersucht, ob diese rechtliche Verpflichtung de facto eingehalten wird. Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Politische Wissenschaft an der FAU Erlangen-Nürnberg und dem V-Dem Institut an der Universität Göteborg durchgeführt. Mit einer auf Experteneinschätzungen beruhenden und methodisch anspruchsvollen Erhebung, die auf probabalistischer Testtheorie basiert, werden umfassende Daten zur Realisierung von Wissenschaftsfreiheit open access zur Verfügung gestellt. Die Daten eröffnen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Forschung aber auch in Wissenschaftsförderung, -management und –politik. Die Förderung ermöglicht auch zwei Postdoc-Projekte an der FAU, die sich den Ursachen und Folgen von Einschränkungen (respektive Verbesserungen) der Wissenschaftsfreiheit widmen.
Projektleitung: Prof. Dr. Michael Krennerich
Zeitraum: 2023 – 2024
Projektbeschreibung:
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie im Zusammenspiel von Zivilgesellschaften, Nationalstaaten und der Staatengemeinschaft soziale Menschenrechte kodifiziert, ausgelegt und durchgesetzt werden. Dabei erfolgt eine fundierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit sachlichen Einwänden gegen soziale Menschenrechte (Stichwort: overreach) sowie mit strukturellen Hindernissen und gesellschaftspolitischen Widerständen, welche die Umsetzung sozialer Menschenrechte behindern. Die Forschungsaktivitäten bauen auf dem Standardwerk von Michael Krennerich “Soziale Menschenrechte. Zwischen Recht und Politik” (2013) sowie zahlreiche wissenschaftliche Beiträge und Vorträge zu dem Thema in den vergangenen Jahren auf. 2023 wird diesbezüglich der wissenschaftliche Austausch mit Forschenden im europäischen Ausland (Österreich, Slowakei etc.) forciert. Für 2023/2024 ist eine weitere grundlegende Schrift zu sozialen Menschenrechten vereinbart, die in der UTB-Lehrbuchreihe erscheinen wird.
Projektleitung: Prof. Dr. Katrin Kinzelbach; Prof. Dr. Georg Glasze und Prof. Dr. Blake Walker
Projektmitarbeiterinnen: Lama Ranjous und Raphaela Edler
Laufzeit: 01. September 2022 – 31. August 2025
Förderung: BMBF
Projektbeschreibung:
Das Projekt „Geo-Daten zur digitalen Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen“ (GeoDatRights) hat zum Ziel, a) anhand von satellitengestützter Fernerkundung und Social Media-Daten die Zerstörung und militärische Aneignung von Bildungseinrichtungen in Kriegsgebieten zu untersuchen, sowie b) im Laufe des Projekts digitale Analysekompetenzen in der deutschsprachigen Menschenrechtsforschung zu etablieren. Die FAU hat bereits ein ausgeprägtes Menschenrechtsprofil und will dieses zukunftsweisend erweitern. International spielen digitale Menschenrechtsuntersuchungen in Forschung und Lehre eine zunehmend wichtige Rolle, in Deutschland befassen sich bisher nur vereinzelt Nichtregierungsorganisationen mit dem Thema, insbesondere die von Syrern gegründete Organisation Mnemonic, dessen umfangreiches, digitales Archiv von den Doktorandinnen im GeoDatRights-Projekt erschlossen werden wird. Angriffe auf Bildungseinrichtungen in Syrien stehen im Zentrum unserer Analyse. Die zwischenstaatliche Erklärung Safe Schools Declaration enthält eine Reihe von Verpflichtungen, die den Schutz von Bildungseinrichtungen vor Angriffen stärken und die Nutzung von Schulen und Universitäten für militärische Zwecke einschränken sollen. Die Unterzeichnerstaaten der Safe Schools Declaration (darunter auch Deutschland im Jahr 2018) haben zudem einer Reihe von Verpflichtungen zugestimmt, die auch die Dringlichkeit eines verlässlichen Monitorings betonen. Im GeoDatRights-Projekt wird die Nutzbarmachung von satellitengestützter Fernerkundung für diesen Zweck erprobt, wobei wir auf eine interdisziplinäre Kooperation mit der Geographie aufbauen, um die Methodenkompetenz aus der digitalen Geographie für die empirische Menschenrechtsforschung zu erschließen.
Projektleitung: Prof. Dr. Michael Krennerich
Herausgeber*innenkreis: Prof. Dr. Michael Krennerich, Prof. Dr. Christina Binder, Dr. Tessa Debus, Prof. Dr. Elisabeth Holzleithner, Prof. Dr. Arnd Pollmann, Dr. Janika Spannagel, Prof. Dr. Stefan Weyers
Zeitraum: 2007 – heute
Förderung: Wochenschau-Verlag; Anschubfinanzierung: Auswärtiges Amt; einzelner Hefte: BMZ/GIZ sowie „Wertvolle Zukunft. Stiftung für ethisches Handeln“
Webseite: www.zeitschriftfuermenschenrechte.de
Projektbeschreibung:
Die seit 2007 erscheinende Zeitschrift für Menschenrechte. Journal for Human Rights (zfmr) ist die führende deutsch-/(englisch)-sprachige, interdisziplinäre Fachzeitschrift zu Menschenrechten und Menschenrechtspolitik im deutschsprachigen Raum. Sie führt aktuelle und systematische Menschenrechtsfragen der Analyse und Reflexion zu, und zwar aus Sicht der Politik-, Geschichts- und Rechtswissenschaften sowie der Philosophie, Soziologie und Pädagogik. Leitender Herausgeber und Chefredakteur ist Michael Krennerich, der gemeinsam mit Kolleg:innen aus Deutschland und Österreich die zfmr plant und erstellt. Bislang haben rund 220 Autor:innen aus unterschiedlichen Weltregionen Beiträge zur zfmr beigetragen.
Herausgeber*innenkreis: Prof. Dr. Simone Derix, Prof. Dr. Jan Eckel, Prof. Dr. Andreas Frewer, Dr. Rainer Huhle, Prof. Dr. Katrin Kinzelbach, Dr. Daniel Stahl, Prof. Dr. Annette Weinke.
Laufzeit: 1. Juni 2020 – heute
Förderung: Fritz Thyssen Stiftung
Projektbeschreibung:
Das Wissenschaftsportal www.geschichte-menschenrechte.de wurde 2015 vom Arbeitskreis Menschenrechte im 20. Jahrhundert (Universität Jena) ins Leben gerufen. Seit dem Juni 2020 ist das Projekt an der FAU angesiedelt. Es versammelt lebensgeschichtliche Interviews und Kommentare, die die Entwicklung der Menschenrechte seit dem 20. Jahrhundert historisierend reflektieren. Im Zentrum stehen nationale und internationale Akteure, Konzeptionen und Praktiken: Auf welche Weise und mit welchen Motiven trieben und treiben verschiedene Gruppen und Individuen die menschenrechtliche Normsetzung voran? Welche Praktiken entstehen daraus? Welche Rollen spielen Arenen wie die UNO, der Europäische Gerichtshofe für Menschenrechte oder der Internationale Strafgerichtshof? Mit welchen Begründungen operieren Anhänger und Gegner der Menschenrechte?
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Katrin Kinzelbach
Projektmitarbeiterin: Dr. Alexandra Kaiser
Laufzeit: 1. Juli 2021 – 31. Dezember 2023
Förderung: BMBF
Projektbeschreibung:
Das Projektteam analysiert den rechtlichen Rahmen und die institutionelle Ausgestaltung sowie die Rechtswirklichkeit und die Praxis des Rechts auf Wissenschaftsfreiheit in der Volksrepublik China. Eine systematische, rechtliche und sozialwissenschaftliche Aufarbeitung der Wissenschaftsfreiheit in der Ära Xi Jinping ist von größter Bedeutung für den Versuch, die aktuellen Möglichkeiten und Grenzen des chinesischen Forschungs- und Innovationssystems besser zu verstehen. Eine in den Vereinten Nationen verhandelte Definition von Wissenschaftsfreiheit wird als Maßstab übernommen. Neben der Analyse des geltenden Rechts, politischer Richtlinien sowie Universitätssatzungen in chinesischer Sprache werden wir ausgewählte Institutionen näher untersuchen, Interviews und eine Umfrage durchführen. Im Verbund mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) werden wir einen bibliometrischen Ansatz pilotieren, um die Freiheit des akademischen Austauschs nach Disziplinen disaggregiert zu messen. Ziel ist der wohlinformierte Ausbau der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit der Volksrepublik China bei selbstbewusster Wahrung der Normen und Voraussetzungen, die in Deutschland und Europa als Fundament für Forschung und Innovation gelten.
Projektleitung: Prof. Dr. Michael Krennerich
Zeitraum: 2022 – 2024
Förderung: Friedrich-Naumann-Stiftung für Übersetzung und Publikation ins Englische
Projektbeschreibung:
Erforscht wird, wie mithilfe der Politikwissenschaft und benachbarter Disziplinen die komplexe Realität der Menschenrechtspolitik systematischer beschrieben und untersucht werden kann. Ein erstes Ergebnis ist das von Michael Krennerich verfasste deutschsprachige Buch „Menschenrechtspolitik. Eine Einführung“ (2023), das für den englischsprachigen Raum in den Jahren 2023/2024 aufgearbeitet und übersetzt werden wird.
Projektleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt
Zeitraum: 2020-2023
Kooperationspartner: Jesuit Worldwide Learning – Higher Education at the Margins
Projektbeschreibung:
Die Menschenrechte gewinnen ihre konkrete Gestalt und (begrenzte) Durchschlagskraft im Medium positiven Rechts. Dass sie zugleich aber über die Ebene positiven Rechts hinausweisen, zeigt sich indes sogar in den einschlägigen Texten selbst, etwa in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, die sich in der Präambel zur „inhärenten Würde“ aller Menschen bekennt. Die gebotene Achtung der Menschenwürde erhält institutionelle Rückendeckung durch universale Rechte gleicher Freiheit. Wie die tragenden Prinzipien der Menschenrechte zu verstehen und angemessen umzusetzen sind, bleibt nach wie vor umstritten. In Kooperation mit „Jesuit Worldwide Learning“ hat Heiner Bielefeldt dazu ein Lernprogramm entwickelt, das sich insbesondere an Menschen in Flüchtlingslagern richtet. Das Einführungsbuch „Sources of Solidarity. A Short Introduction to the Foundations of Human Rights” ist 2022 bei FAU Press erschienen und auch online kostenlos verfügbar. Eine portugiesische Fassung ist derzeit in Vorbereitung. Eine Übersetzung ins Indonesische ist geplant. Didaktische Begleitmaterialien zum Lehrbuch werden in Kürze ebenfalls elektronisch zur Verfügung stehen.
Projektleitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt und Prof. Dr. Andreas Frewer
Zeitraum: 2014 – 2021
Förderung: 2014 – 2017 Emerging Fields Initiative (EFI); 2018 – 2021 Josef und Luise Kraft Stiftung
Webseite: https://www.grk.menschenrechte-und-ethik.med.fau.de
Projektbeschreibung:
Viele in der Medizinethik diskutierte Grundfragen, etwa nach dem Stellenwert von Patientenverfügungen oder dem angemessenen Umgang mit Demenzerkrankten weisen menschenrechtliche Brisanz auf. Im Gegenzug gilt, dass Menschenrechte wie das Recht auf Gesundheit für die Medizinethik unmittelbar relevant sind. Im Rahmen der Emerging Fields Initiative (EFI) der FAU haben Andreas Frewer und Heiner Bielefeldt mehrere Konferenzen durchgeführt und eine Bücherreihe („Human Rights in Healthcare“) herausgegeben, innerhalb derer sieben Bände erschienen sind. Unterstützt von der Kraft-Stiftung (München) führten beide von 2018 bis 2021 ein Graduiertenkolleg über „Menschenrechte und Ethik in der Medizin für Ältere“ durch.
Projektleitung: Prof. Dr. Michael Krennerich
Zeitraum: 2020 – 2022
Förderung: Förderung der Friedrich-Ebert-Stiftung für Übersetzungen und Publikationen
Projektbeschreibung:
Auf Grundlage einer weltweiten Untersuchung von Verfassungen, Wahlgesetzen, Webseiten von Wahlbehörden und Wahlbeobachterberichten wurden wahlrechtliche und wahlpraktische Standards freier und fairer Wahlen systematisch dargelegt und deren Einhaltung in der Wahlpraxis problematisiert. Resultat war das von Michael Krennerich verfasste Buch „Freie und faire Wahlen? Standards, Kurioses, Manipulationen“ (2020), das auf Deutsch inzwischen in 2. Auflage (2021) erschienen ist und in überarbeiteter Form auch ins Englische („Free and Fair Elections? Standards, Curiosities, Manipulations“, 2021) und ins Französische („Des élections libres et transparentes? Normes, curiosités, manipulations“, 2022) übersetzt wurde.
Weiterhin erstellte Michael Krennerich eine Studie „Wahlrecht von wohnungslosen Menschen. Rechtliche, organisatorische und politische Bedingungen der Wahlrechtsnutzung durch wohnungslose Menschen“ (2021) für das Deutsche Institut für Menschenrechte und wirkte an einer gemeinsamen internationalen Studie „The 2021 German Federal Election on Social Media. An Analysis of Systemic Electoral Risks Created by Twitter and Facebook Based on the Proposed EU Digital Services Act.” Sustainable Computing Lab/ Wirtschaftsuniversität Wien (2021) mit.
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel; Prof. Dr. Michael Krennerich
Zeitraum: 2017-2019
Förderung: Studienstiftung des Deutschen Volkes
Projektbeschreibung:
Das Projekt „Flucht und Menschenrechte“ wurde als Gesellschaftswissenschaftliches Kolleg der Studienstiftung des deutschen Volkes realisiert. Die Ergebnisse wurden in der von Petra Bendel und Michael Krennerich herausgegebene Buchpublikation „Flucht und Menschenrechte“ (2020) festgehalten, die open access im Universitätsverlag der FAU erschienen ist: Flucht und Menschenrechte | Neuerscheinungen (fau.de)
Personen
Migration, Flucht und Integration

Die Migrations-, Flucht- und Integrationsforschung am Institut ist auf den verschiedenen politischen Ebenen angesiedelt: global /international, regional, national und lokal. Unsere Teams sind national und international breit in die Forschung hinein vernetzt und außerdem aktiv in der Politikberatung und im Wissenstransfer in Politik und Medien. Die Forschung in diesem Bereich profitiert auch durch die institutionelle Brücke zum Thema Migration und Menschenrechte, denn unsere Projekte sind eng mit dem FAU Forschungszentrum Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg (CHREN) verknüpft und zum Teil auch dort angebunden.
Laufende Forschungsprojekte
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel
Projektmitarbeiterin: Tino Trautmann
Laufzeit: 01.01.2020 – 31.12.2029
Projektwebseite: FFVT – Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer & FAU CHREN Research: FFVT
Projektbeschreibung:
FFVT – Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer ist ein Verbundprojekt des Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg (CHREN) gemeinsam mit dem Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück, dem Bonn International Center for Conversion (BICC) und dem German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Bonn. Gefördert wird dieses Verbundprojekt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Auf FAU-Seite leitet das Projekt Prof. Dr. Petra Bendel, unterstützt durch Tino Trautmann und Karolina Kohl. Ziel ist es, die Flucht- und Flüchtlingsforschung durch nationale und internationale Vernetzung zu stärken.
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel
Projektmitarbeiterin: Yasemin Bekyol, Theresa Wagner
Kooperationspartner: Dr. Tobias Weidinger und Dr. Stefan Kordel, Institut für Geographie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Laufzeit: 15.09.2022 – 31.01.2026
Projektwebsite: Gesundheit! Teilhabe im Pflegesektor & FAU CHREN: Gesundheit!
Projektbeschreibung:
Vor dem Hintergrund eines sich verstärkenden Personalbedarfs im Gesundheits- und Pflegebereich und sich immer häufiger abzeichnender Versorgungslücken, sind Arbeitskräfte aus dem Ausland bereits jetzt nicht mehr wegzudenken. Ihre Anwerbung, vor allem aber auch nachhaltige Beschäftigung hängt maßgeblich von den Arbeitsbedingungen und ihrer beruflichen und sozialen Teilhabe ab. Das neue Forschungsprojekt greift diese Problematik auf und möchte gute Bedingungen für Beschäftigte mit Migrationsgeschichte im Pflegesektor identifizieren, um ihre Bleibeorientierung zu stärken.
Auf der Grundlage qualitativer Erhebungen sowie anhand von Workshops sollen wissenschaftliche Erkenntnisse über Handlungsspielräume und gute Praxisbeispiele von Kranken-/Pflegeeinrichtungen und Kommunen für eine teilhabeorientierte und chancengerechte Beschäftigung erlangt werden. Ziele des Projekts sind es Impulse und Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der beruflichen und sozialen Teilhabe von prekär beschäftigten Pflegekräften mit Migrationsgeschichte zu formulieren und Vertreter:innen aus Kommunen (insbesondere aus strukturschwachen) bei der konkreten Ausgestaltung dieser Maßnahmenpakete zu unterstützen.
Das Projekt wird von der Stiftung Mercator gefördert und ist am FAU Forschungszentrum Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg (FAU CHREN) angesiedelt. Kooperationspartner ist das Institut für Geographie der FAU.
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel, Prof. Dr. Hannes Schammann und Dr. Danielle Kasparick, Universität Hildesheim
Projektmitarbeiter:innen: Sonja Reinhold, FAU
Laufzeit: 01.05.2024 – 30.04.2028
Immer wieder stellen steigende Zahlen der Fluchtzuwanderung Kommunen vor die Herausforderung, möglichst schnell Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten bereitzustellen. In Zeiten sinkender Zuzüge jedoch werden Kapazitäten regelmäßig abgebaut. Bei einem erneuten Anstieg der Zahlen müssen dann wieder behelfsmäßige Lösungen eingerichtet werden. Dies ist für die Kommunen extrem aufwändig und bindet personelle und finanzielle Ressourcen, die an anderen Stellen dringend gebraucht würden. Zudem bieten die ad hoc gefundenen, wenig nachhaltigen Lösungen gerade für vulnerable Personen oft keine bedarfsgerechten Strukturen.
Wissenschaftlich fundierte Lösungsansätze, die sich der Unterbringung von Geflüchteten widmen, bleiben bislang meist auf einem abstrakten Niveau und werden der Heterogenität kommunaler Strukturen oft nicht gerecht. Kommunen müssen so konkrete Lösungen oft selbst entwickeln. Auf praktischer Ebene beobachten wir im internationalen Raum zwar hier und dort innovative Ansätze, die unter großem lokalem Engagement entstehen und sich als Good Practice erweisen könnten – diese sind allerdings nur in einzelnen Fällen systematisch erprobt und auf ihre Skalierbarkeit untersucht.
In dem Projekt „Mehr als vier Wände – Innovative Ideen für eine zukunftsfähige Unterbringung in und mit Kommunen“ möchten die Universität Hildesheim und die FAU Erlangen-Nürnberg daher vorhandene Potentiale erheben und innovative und nachhaltige Konzepte zum Wohnen für Geflüchtete gemeinsam mit den Praxis-Akteuren so (weiter-)entwickeln, dass sie in Kommunen umgesetzt werden können. Hierfür wird das Projektteam mit strukturell unterschiedlichen Kommunen kooperieren, die ihre bisherigen Lösungen analysieren, gemeinsam neue Wege entwickeln und diese in der Praxis umsetzen möchten.
An der FAU Erlangen-Nürnberg ist das Projekt am Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration sowie dem FAU Forschungszentrum Center for Human Rights Erlangen-Nürnberg (FAU CHREN) angesiedelt, es läuft vom 01.05.2024 bis 30.04.2028 und wird von der Stiftung Mercator gefördert.
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Auftragsstudie des Europäischen Parlaments
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel
Projektmitarbeiterin: Yasemin Bekyol
Laufzeit: Januar – Juni 2016
Projektbeschreibung:
Speziell die Rechte von Frauen und Mädchen bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in Europa stehen im Fokus dieser empirischen Untersuchung.
Die Studie erfolgte im Auftrag des Ausschusses für Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit (The Committee on Women’s Rights and Gender Equality, FEMM) des Europäischen Parlaments. Hintergrund war die Frage nach der Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie im europäischen Vergleich mit einem Schwerpunkt auf Deutschland und Belgien.
Das Team begleitete auch eine Delegation von Abgeordneten des Europäischen Parlaments nach München und Brüssel, erstellte untenstehende Studie und stand dem Europäischen Parlament für weitere Expertisen zur Verfügung.
Ab sofort ist die Studie hier abrufbar:
Bekyol Yasemin, Bendel Petra (2016): „Reception of female refugees and asylum seekers in the EU – Case study Belgium and Germany“, Studie im Auftrag des Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens´Rights and Constitutional Affairs, Women´s Rights & Gender Equality, Brüssel, 54 Seiten. Zur Studie.
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel
Projektmitarbeiterin: Yasemin Bekyol
Laufzeit: 01.08.2020 – 31.03.2021
Projektwebsite: covid-integration.fau.de
Projektbeschreibung:
Die von der FAU Erlangen-Nürnberg unter Beteiligung der Stiftungsuniversität Hildesheim und mit Unterstützung der Stiftung Mercator durchgeführte Studie untersucht die Auswirkung der durch die Pandemie veränderten Umstände auf Migrationsbewegungen und auf die Integration in Deutschland. Das COVID-19 Virus hat sich außerordentlich schnell verbreitet und unter anderem Mobilität und Migration zumindest kurzfristig stark eingeschränkt. Neben einer Gesundheitskrise hat Covid-19 auch zu einer ökonomischen Krise geführt, deren Ausmaß wir noch nicht erfassen können. Für viele Bevölkerungsgruppen ist der Zugang zu wirtschaftlicher Teilhabe, zum Wohnen, zu Ernährung und Bildung eingeschränkt. Auf Grundlage einer umfassenden Literaturrecherche sowie anhand eines Scenario-Buildings entwirft die Studie ein Zukunftsbild anhand der Frage: Wie sieht Integration in Deutschland im Jahr 2030 aus? Ziel ist es, mit Expertinnen und Experten mehrere plausible Szenarien zur mittelfristigen Zukunft der Migration und vor allem der Integration in Deutschland zu entwickeln. Die Studie strebt zusätzlich an, auf Grundlage dieser Szenarien Handlungsempfehlungen zu generieren, und problematisiert schließlich die Frage, welche Weichen politische Entscheidungsträger und gesellschaftliche Akteure stellen können, um den besonderen Herausforderungen einer nur begrenzt planbaren Integrationspolitik gerecht zu werden.
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel
Projektmitarbeiterinnen: Sonja Reinhold, Theresa Wagner
Laufzeit: 01.11.2020 – 31.03.2023
Studie zum Download: „Brennglas Corona: Lokale Integrationsarbeit in Zeiten einer globalen Pandemie„, 2022
Interview zu den Ergebnissen der Studie: „Studie Brennglas Corona: ‚Wir müssen die Kommunen resilienter machen‘“
Projektbeschreibung:
Die von der Robert Bosch Stiftung geförderte explorative Studie untersucht die konkreten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Integrationsarbeit in den Kommunen. Diese stehen angesichts knapper Ressourcen teilweise bereits strukturellen Herausforderungen gegenüber. Im Zuge dieser Pandemie und des mit ihr verbundenen ‚Lockdowns‘ der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens werden die Teilhabe- und Integrationsbedingungen auf der lokalen Ebene zusätzlich erschwert – die pandemische Situation wirkt wie ein Brennglas. Dies droht sich nicht nur auf die Teilhabe der bereits eingewanderten Personen, sondern auch auf die Aufnahme und Integration der künftig neu zuwandernden Migrant:innen und Geflüchteten auszuwirken.
Mittels einer qualitativen Untersuchung sollen die konkreten Erfahrungen und Bedarfe kommunaler, integrationspolitisch relevanter Akteure im Zuge der Corona-Pandemie identifiziert werden und auf dieser Basis Handlungsempfehlungen formuliert werden. Ziel der Studie ist es, Entscheidungsträger:innen aller föderalen Ebenen für die aktuellen Herausforderungen in den Kommunen zu sensibilisieren und kommunale Integrationsarbeit langfristig zu stärken.
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel
Projektmitarbeiter:innen: Dr. Janina Stürner-Siovitz
Projektwebsites: Equal Partnerships – African Intermediary Cities as Actors and Partners in Urban Migration Governance & FAU CHREN: Equal Partnerships
Laufzeit: 01.11.2021 – 31.10.2024
Projektbeschreibung:
Der Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration freut sich über die Bewilligung des neuen Forschungsprojekts „Equal Partnerships – African Intermediary Cities as Actors and Partners in Urban Migration Governance“. Das Projekt erforscht die Chancen und Herausforderungen kollaborativer, urbaner Migrationsgovernance in afrikanischen Sekundärstädten in Zusammenarbeit mit dem German Institute of Development and Sustainability (IDOS), dem Think Tank Samuel Hall und dem Städtenetzwerk United Cities and Local Governments of Africa (UCLG Africa). Durch partizipative Forschung und Dialogformate bringt das Projekt lokale, nationale und internationale Akteure zusammen, um gemeinsam praktische Impulse und politische Handlungsempfehlungen für ebenbürtige Partnerschaften urbaner Migrationsgovernance zu entwickeln.
Dabei kooperieren die Projektpartner mit Sekundärstädten – einer Stadtform die zunehmende Aufmerksamkeit von Forschung und Politik auf sich zieht. Sekundärstädte sind immer häufiger mit Herausforderungen von klimainduzierter Migration, Transitmigration und Land-Stadt-Migration konfrontiert, bergen jedoch auch besondere Chancen durch urbane Migrationsgovernance Innovation und Entwicklungspotentiale für Länder und Regionen freizusetzen.
Das Projekt „Equal Partnerships“ wird von der Robert Bosch Stiftung gefördert und ab Projektstart am 1. November 2021 am Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg (CHREN) angesiedelt.
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel, Prof. Dr. Hannes Schammann und Dr. Danielle Kasparick, Universität Hildesheim
Projektmitarbeiter:innen: Sonja Reinhold, FAU, und Katharina Euler, Universität Hildesheim
Projektwebsites: Match’In: Pilotprojekt zur Verteilung von Schutzsuchenden & FAU CHREN: Match’In
Laufzeit: 01.05.2021 – 30.04.2025
Das Match’In-Projekt verfolgt das Ziel, gemeinsam mit Bundesländern, aufnehmenden Kommunen und Vertreter*innen von Geflüchteten (z. B. Selbstorganisationen oder Unterstützer:innengruppen), in einem Pilotprojekt einen Mechanismus zu entwickeln, durch welchen individuelle Aspekte bei der Verteilung von Schutzsuchenden berücksichtigt werden können. Mithilfe eines Algorithmus‘ sollen die Voraussetzungen und Bedürfnisse der Schutzsuchenden sowie die vorhandenen Strukturen und Ressourcen der Kommunen in eine stärkere Übereinstimmung gebracht werden („Matching“). So sollen Bedürfnisse von Schutzsuchenden besser berücksichtigt, das Potenzial von Migration für kommunale Entwicklung besser genutzt, Integration und Teilhabe verbessert und Sekundärmigration verringert werden. Das Projekt wird durch die Stiftung Mercator gefördert.
Am Projekt nehmen das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport, das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz sowie das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen teil.
Im Rahmen der dreijährigen Projektlaufzeit sollen die relevanten Kriterien auf Seiten der aufnehmenden Kommunen und der zu verteilenden Schutzsuchenden ermittelt, ein Matching-Algorithmus programmiert und in ausgewählten Pilotkommunen erprobt werden. Bei der Durchführung des Projekts werden ethische Grundlagen sowie die Erfordernisse des Datenschutzes berücksichtigt. Um die Ergebnisse des Projektes zu sichern und Handlungsempfehlungen für eine mögliche breitere Umsetzung zu entwickeln, wird das Projekt wissenschaftlich begleitet. Darüber hinaus werden die Erfahrungen im letzten Projektjahr in Form eines Policy Briefs publiziert und mit Entscheidungsträger*innen auf verschiedenen politischen Ebenen diskutiert.
Ansprechpartnerin an der FAU:
Sonja Reinhold LL.M.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin des Forschungsbereichs Migration, Flucht und Integration
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
sonja.reinhold@fau.de
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel, Prof. Dr. Yesim Erim, Prof. Dr. Silke Jansen, Prof. Dr. Nicolas Rohleder
Projektmitarbeiter:innen: Mojib R. Atal, Andrea Borho, Felicitas Hauck, Lucía Romero Gibu
Projektwebseite: Verbal Violence against Migrants in Institutions (VIOLIN)
Laufzeit: 01.04.2019 – 31.03.2022
Projektbeschreibung:
VIOLIN ist eine Kooperation zwischen Politikwissenschaft, Sprachwissenschaft, Gesundheitspsychologie und Psychosomatik.
In diesem Projekt liegt der Schwerpunkt auf verborgene Formen von Ausgrenzung und symbolischer Gewalt im institutionellen Umfeld gegenüber Migrantinnen und Migranten. Ziel des Projekts ist, diese Form der Gewalt sichtbar zu machen und aus den gewonnenen Erkenntnissen ein umfassendes Modell zur Integration von Migranten in neuen soziokulturellen Umgebungen zu entwickeln.
Das Projekt wird finanziell unterstützt von der STAEDTLER Stiftung
Stiftungsfinanzierte Studie
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel
Projektmitarbeiter: Daniel Riemer
Laufzeit: Januar – Mai 2016
Aufnahme, Unterbringung, Zugang zu Gesundheit, Bildung und Informationen sowie Arbeit und Freizeit von Flüchtlingen sind drängende Fragen der Integration von Flüchtlingen auf der Ebene von Ländern und Kommunen. Erheblicher Bedarf besteht an Information über gute Praktiken und an einer Vernetzung bereits bestehender Projekte in den einzelnen Bereichen. Kommunen, haupt- und ehrenamtliche Unterstützer und Dienstleister haben angesichts des aktuellen „Notfall-Modus“ nicht die Zeit und die Möglichkeit, Kriterien für gute Praktiken zu entwickeln und bereits existierende Integrationsprojekte auf ihre etwaige Übertragbarkeit hin zu überprüfen.
Hier setzt das geplante Projekt „Voneinander lernen: Best practice-Beispiele in der kommunalen Flüchtlingspolitik“ an. Angesiedelt am Zentralinstitut für Regionenforschung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und aufbauend auf einem hier durchgeführten Pilotprojekt zu den Bedürfnissen der Flüchtlinge selbst, entwickelt es Kriterien für die Auswahl guter und bester Praktiken, gefolgt von einer Recherche und Kategorisierung einer Vielzahl von innovativen Praxisprojekten im Bundesgebiet und einer In-Depth-Studie ausgewählter Projekte vor Ort.
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel und Prof. Dr. Hannes Schammann, Universität Hildesheim
Projektmitarbeiter:innen: Janina Stürner, M.A. und Dipl.-Soz. Christiane Heimann
Laufzeit: 01.04.2018 – 31.10.2021
Projektwebseite: Im Entstehen
Projektbeschreibung:
This innovative academic project evaluates the impact of transnational cities’ networks on European migration policies and develops guidelines in cooperation with politicians and practitioners to strengthen their work in the European multi-level governance system. To this end, the activities of formal and informal transnational cities’ networks are examined. A special focus is placed on the EUROCITIES network, from which the movement of Solidarity Cities originated. This movement aims at demonstrating cities’ political leadership in light of integration and relocation challenges within the European Union. Besides, the EUROCITIES build the Council of European Municipalities and Regions, which is the European umbrella organisation of municipal associations in the member states. This study analyses both network activities and strategies of individual network members, such as Athens (Greece), Barcelona (Spain), Essen (Germany), Gdansk (Poland), Ghent (Belgium), Leeds (United Kingdom), Ljubljana (Slovenia) and Palermo (Italy). A mixed-methods approach is applied, combining the analysis of policy documents and expert interviews. The latter include interviews with experts of the EUROCITIES network as well as the local and the EU level. The guiding research question of this study is: How can local bottom-up agenda setting address the current migration governance crisis of the European Union in a transnational way? Hence, the aim of the project is threefold. Firstly, it offers insights into the strategies the different cities pursue and the transnational relations they use in accordance to their interests. Secondly, it evaluates the mechanisms initiated by the municipal associations with regard to their specific target. Thirdly, guidelines are developed in cooperation with politicians and practitioners and published in policy briefs, which are presented in a final meeting in Brussels. Due to the current brisance of this topic, its highly innovative perspective on the making of EU migration policies and the lack of research in this area, this project will set a milestone in understanding the role and power of municipal associations in a newly unfolding sphere of European multi-level migration governance.
Das von der Mercator-Stiftung geförderte Projekt evaluiert von 2018 bis 2021 den Einfluss von Städtenetzwerken auf europäische Migrationspolitik. Es entwickelt prozessbegleitend Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis. Zu diesem Zweck werden die Aktivitäten formeller und informeller Netzwerke untersucht. Im Zentrum stehen das Eurocities-Netzwerk, das u.a. den Entstehungskontext der auf Migrationspolitik zielenden Bewegung „Solidarity-Cities“ bildet, sowie der Council of European Municipalities and Regions, der die europäische Dachorganisation nationaler Kommunalverbände darstellt (u.a. Deutscher Städtetag). Dabei werden sowohl die Netzwerkaktivitäten als auch das Handeln einzelner Städte (tentativ: Athen, Barcelona, Essen, Gdansk, Ghent, Leeds, Ljubljana, Palermo) innerhalb der Netzwerke betrachtet.

Dipl.-Soz. Christiane Heimann, Prof. Dr. Hannes Schammann, Prof. Dr. Petra Bendel
Team:
Prof. Dr. Petra Bendel
Zentralinstitut für Regionenforschung
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen
Telefon: +49 (0)9131 85-22368
Email: petra.bendel@fau.de
Prof. Dr. Hannes Schammann
Institut für Sozialwissenschaften
Hildesheim Universität
Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim
Telefon: +49 (0)5121 883-10712
Email: hannes.schammann@uni-hildesheim.de
Janina Stürner, M.A.
Zentralinstitut für Regionenforschung
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen
Telefon: +49 (0)9131-85-26421
Email: janina.stuerner@fau.de
Dipl.-Soz. Christiane Heimann
Institut für Sozialwissenschaften
Hildesheim Universität
Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim
Telefon: +49 (0)5121 883-10772
Email: heimann@uni-hildesheim.de
Projektleitung: Prof. Dr. Petra Bendel und Prof. Dr. Hannes Schammann, Universität Hildesheim
Projektmitarbeiterin: Sandra Müller, M.A.
Laufzeit: 01.09.2017 bis 31.05.2020
Projektwebsite: Im Entstehen
Wie unterscheiden sich integrationspolitische Strukturen in Stadt und Land? Wie lassen sich Unterschiede in der institutionellen Struktur von Integrationspolitik erklären? Lässt sich seit der erhöhten Zuwanderung in den Jahren 2015 und 2016 ein institutioneller Wandel erkennen? Was können städtische und ländliche Kommunen mit Blick auf ihre Integrationspolitik voneinander lernen? Diesen Forschungsfragen widmen sich Wissenschaftlerinnen der Universität Hildesheim und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) unter der Leitung von Prof. Dr. Petra Bendel (Erlangen) und Prof. Dr. Hannes Schammann (Hildesheim). Eine qualitative Analyse integrationspolitischer Strukturen von rund einhundert Kommunen im gesamten Bundesgebiet ermöglicht es, Fragen hinsichtlich der Institutionalisierung kommunaler Integrationspolitik mit dem Fokus auf spezifische Stadt-Land-Themen zu beantworten. Das Projekt strebt insbesondere einen Vergleich von strukturschwachen und strukturstarken Kommunen in ländlichen wie in städtischen Gebieten an.

Team:
Prof. Dr. Petra Bendel
Zentralinstitut für Regionenforschung
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen
Telefon: +49 (0)9131 85-22368
Email: petra.bendel@fau.de
Prof. Dr. Hannes Schammann
Institut für Sozialwissenschaften
Hildesheim Universität
Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim
Telefon: +49 (0)5121 883-10712
Email: hannes.schammann@uni-hildesheim.de
Sandra Müller, M.A.
Institut für Sozialwissenschaften
Hildesheim Universität
Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim
Telefon: +49 (0)5121 883-10770
Email: sandra.mueller@uni-hildesheim.de
Studie: „Zwei Welten? Integrationspolitik in Stadt und Land?“
Ende Juni 2020 erschien die Studie zum Projekt. Die Publikation kann als PDF auf der Webseite der Robert Bosch Stiftung heruntergeladen werden. Hier geht es zur ![]() Studie.
Studie.
1.7.2020: Im Migazin erscheint der Artikel „Studie: Kommunen haben Integrationsmanagement verbessert“. ![]() Zum Artikel.
Zum Artikel.
30.6.2020: In der „Neue Wiesentbote“ erscheint unter der Überschrift „FAU: Zwei Welten? Integrationspoltik in Stadt und Land“ ein Artikel. ![]() Zum Artikel.
Zum Artikel.
Two worlds apart? Comparing local integration politics in urban and rural municipalities in Germany
How do municipalities in urban and rural regions in Germany organize the reception and inclusion of immigrants? Can we identify institutional change in local integration politics after the massive arrival of refugees in 2015 and 2016? How can we explain the divergence/convergence of institutional settings? To what extent can urban and rural communities learn from each other? These are some of the research questions we will answer by analysing approximately 100 municipalities and districts (Landkreise) in Germany. In particular, we will focus on ‘urban-rural-comparisons’ and the divergence/convergence between regions that differ significantly regarding their economic prosperity.
The project will run from September 2017 until end of January 2020 and is funded by the Robert Bosch Stiftung.
Team:
Prof. Dr. Petra Bendel
Center for Area Studies
Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg
Bismarckstr. 1, 91054 Erlangen
phone: +49 (0)9131 85-22368
Email: petra.bendel@fau.de
Prof. Dr. Hannes Schammann
Institute of Social Science
University of Hildesheim
Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim
phone: +49 (0)5121 883-10712
Email: hannes.schammann@uni-hildesheim.de
Sandra Müller, M.A.
Institute of Social Science
University of Hildesheim
Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim
phone: +49 (0)5121 883-10770
Email: sandra.mueller@uni-hildesheim.de
Personen






























